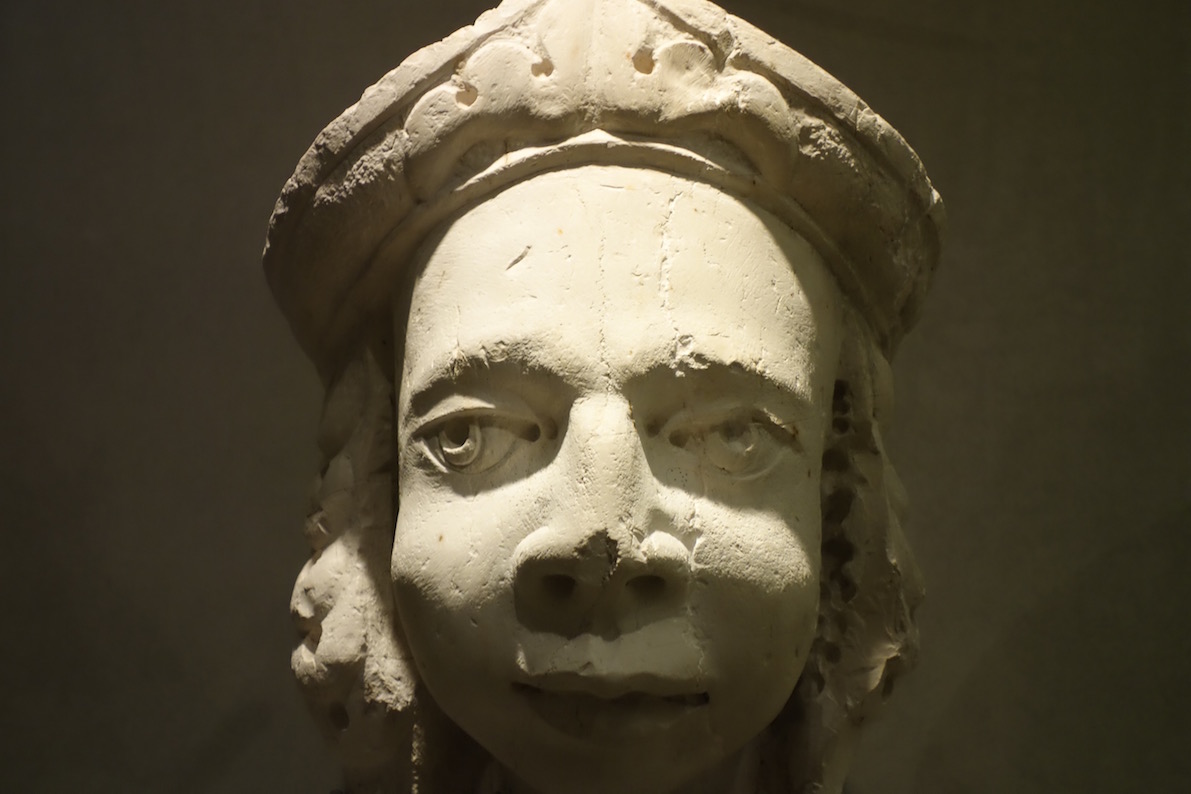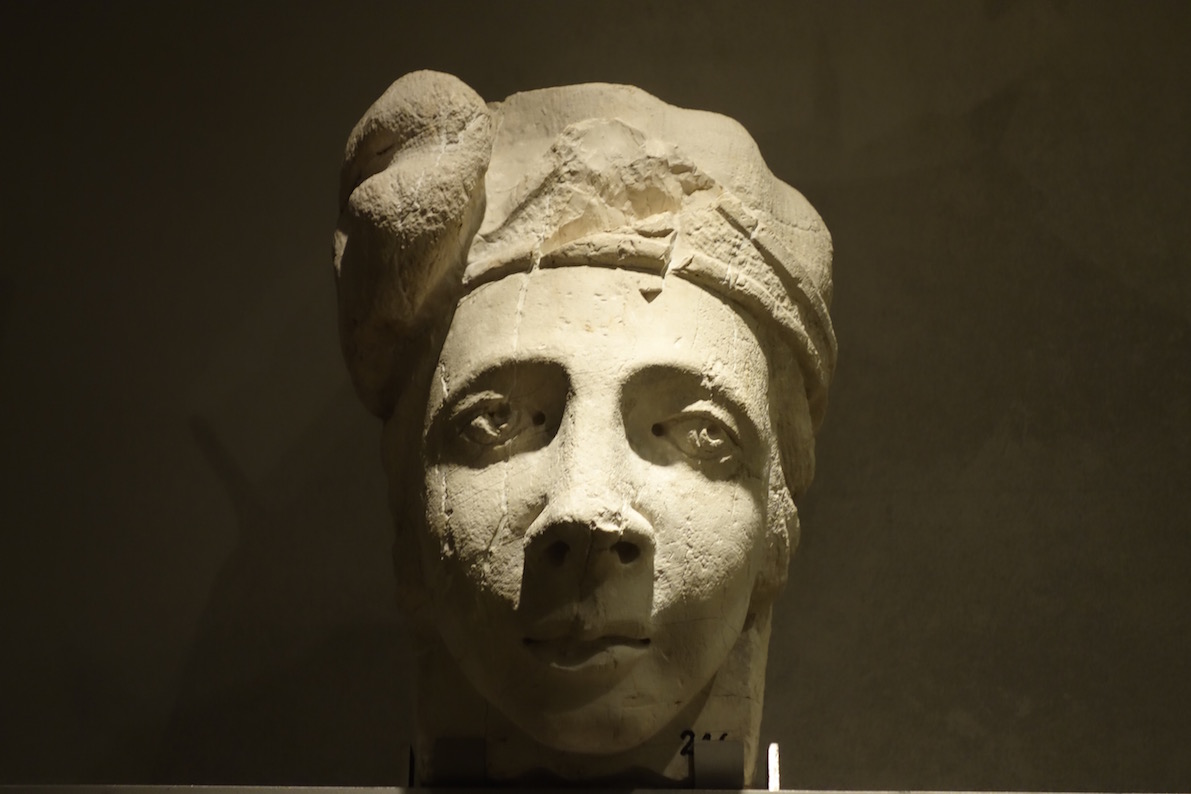Korcula: Dieselpest und Lichtmaschine (Teil 2). Wie Segeln Menschen zusammenbringt.
Im vorigen Post schrieb ich, wie ungeahntes Leben in meinem Tank zu 35 Zentimeter langen organischen Gebilden führt, die unterwegs auf dem Meer LEVJEs Motor lahmlegten. Und was ich einer abgelegenen Bucht dagegen unternahm.
Hier die Fortsetzung:
Am nächsten Morgen steuere ich LEVJE in die kleine Marina Korcula. 158 Liegeplätze gibt es da, nach offizieller Zählung auf der ACI-Website. Aber für Transit stehen davon nur knapp die Hälfte zur Verfügung, also 70. Und davon wiederum sind 4/5 von Flotillen und Charter belegt.
Gleich in der Einfahrt in die Marina betreibt Angelo seine Bootsreparatur und einen Zubehörladen. Eigentlich heißt er Andelko, „Ansche:lko“ gesprochen. Aber weil es leichter zu merken ist, sagt er einfach „Angelo“. Seine Werkstatt brummt. Der Laden ist voll. Er kuckt aus neugierigen, wachen, etwas traurigen Augen in seiner Werkstatt, die nicht größer ist als die Küche einer Siebzigerjahre-Wohnung. Und ein Taubenschlag dazu: Junge Leute, die Außenborder zerlegen. Petar, der Mechaniker, der uns draußen vor der Stadtmauer rettete, schraubt an einem Teil. Einheimische und durchreisende Bootsbesitzer, die ständig mit bittendem Blick Angelos „Küche“ betreten. Es brummt. Es summt. Angelos Laden funktioniert. Mit einem Blick ist klar, dass Geldverdienen nicht Angelos Problem ist.“Wir sind die einzigen Mechaniker zwischen Split und Dubrovnik. Wer ein Problem mit seinem Schiff hat auf den 100 Seemeilen zwischen Split und Dubrovnik: Der kommt hierher.“, sagt Angelo. Er sagt es selbstbewusst und doch bescheiden. Als sei es Last und Verantwortung. Und kein Anlass, sich wie mancherorts in diesen Tagen in Kroatien die Hände über laufendes Geschäft zu reiben.
Ich weiß nicht, wann Andelko seine Werkstatt eröffnete. Irgendwann nach dem Balkankrieg, der hier in der Gegend schlimm wütete. Vielleicht, weil dies Kroatien nicht weit von hier an Bosnien und Montenegro stößt. Im Laden nebendran treffe ich seine Tochter Marina, auf der Suche nach einer 3 Ampere Röhrensicherung. „One Moment, please. I am the daughter of a mechanic, but still a woman. Sorry, Sir: I have to ask my father.“ Ich bin beeindruckt. Dass sich jemand entschuldigt. Weil er etwas nicht weiß.
Zehn Minuten später kommt Petar. Er pumpt 10, 20 Liter Diesel vom Grund meines Tanks, um ihn genau zu untersuchen. Er tut nichts anderes als das, was ich draußen in der verlassenen Bucht auf Lastovo tat: Einfach nachsehen. Ob sich weiterer Schleim, weitere lange Fadengebilde in meinem Tank finden (Siehe mein Post dazu). Petar findet genauso wenig wie ich im Tank. Er sei sauber. „Andelko hat drüben im Laden etwas. Das kippst Du rein. Und dann ist Ruh.“

Danach misst Petar meine zickende Lichtmaschine durch. Er braucht eine Weile. Aber dann kommt Präzises: „Die Lichtmaschine ist hin. Die Trenndiode auch. Wir schicken die Lichtmaschine mit der nächsten Fähre ins 100 Kilometer entfernte Split zur Diagnose und Reparatur. Morgen Abend, spätestens übermorgen, hast Du sie wieder.“
Während ich noch hadere, ob meine Lichtmaschine wirklich erwachsen genug ist, um allein auf einer Fähre in die große Stadt am Meer zu verreisen, treffe ich Marina, die meine Lichtmaschine zur Fähre hinüberfährt, die gleich nach Split abgeht. Ich bin beeindruckt. Zum zweiten und nicht zum letzten Mal an diesem Tag. Als ich Abends von meinen Streifzügen durch die Altstadt von Korcula komme, werkeln die drei immer zusammen mit den Lehrlingen immer noch in der Werkstadt.
Sie fangen morgens um acht Uhr an zu arbeiten. Pause von eins bis drei. Dann arbeiten sie durch bis 21 Uhr, sagt Marina. Ein echter, harter 11-Stunden-Tag jetzt in den Sommermonaten. Inklusive Samstag. „Im Winter sehe ich meine Familie häufiger als jetzt im Sommer“, erzählt Petar. Er ist Vater einer siebenjährigen Tochter und wünscht sich ein zweites Kind. „Das ist mein Job. Im Sommer komme ich vor neun nicht heim. Im Winter hingegen bin ich oft schon am Nachmittag zuhause.“

Am nächsten Morgen frage ich Marina, die Tochter eines Mechanikers, warum sie eigentlich arbeitet. Sie erzählt, dass sie nebenbei auch eine Ferienwohnung vermietet, ein zauberhaftes Ding am Meer. „I like to work. I cannot live without work. I worked for ten years on cruise ships: 9 months work without Sunday. 3 months holiday. Had to finish with breakdown. It has been a perfect job: Working together with 30 other nationalities and mentalities – and no problem.“ Ein Foto von ihr aus dieser Zeit hängt hinter dem Andelkos Schreibtisch an der Wand. Zwischen dem Bild ihres tödlich verunglückten Bruders. Und dem von Andelkos Mutter. Sie sind Menschen, die ihre Wurzeln, ihre Herkunft nicht vergessen haben.
Jeden Tag rühren mich Andelko, Marina, Petar ein wenig mehr, je näher ich sie in jeder Begegnung, in jedem kleinen Gespräch kennenlerne. Vielleicht musste es so sein in diesem Land, in dem es schwer ist, an die Menschen auf den Inseln heranzukommen, weil die Sprachbarriere, weil unterschiedliche Mentalität den Zugang zueinander erschweren. Und weil dieses Kroatien vor allem in seinen lokalen Communities denkt und ein Reisender nur jemand ist, der heute Geld bringt. Und morgen wieder weg ist. Nicht den Blick wert. Im Tourismus-Boom der letzten Jahre
Vielleicht brauchte es genau dies: LEVJEs streikenden Motor. Eine zickende Lichtmaschine. Um das Leben von drei Menschen, ihre Geschichte, ihre Sorgen, ihre Freude kennenzulernen. Um nicht einfach nur weiterzueilen, von Hafen zu Hafen.

Etwa fünf Mal muss Andelko mit der Werkstatt in Split telefonieren. Dann, nach eineinhalb Tagen, am Samstag Mittag, kommt meine Lichtmaschine mit der Fähre um 12 wieder angereist. Die verschmorte Platine ist durch eine neue ersetzt. Als er die Fähre vor dem Hafen anlegen sieht, setzt Petar sich auf seinen Roller. Und fährt hinüber zum Hafen, um sie zu holen. Insel-Business. Nach einer halben Stunde ist sie wieder eingebaut. Und produziert Strom. Ich hoffe, dass sie jetzt klaglos laufen wird. Wie LEVJEs Motor.
Ich? Bin froh, diese drei Menschen kennengelernt zu haben. Ich weiß, ich werde Andelko, Marina, Petar nicht vergessen. Es sind Menschen wie sie, warum ich an dieses Europa glaube.
Vielleicht ist dies auch eine der wichtigen Erfahrungen des Alleinreisens. Ich bin meist allein unterwegs. Und brauche doch andere Menschen mehr als ich denke. Wieder fallen mir die Zeilen von Charles Darwin ein, die ich vor drei Jahren in dem Post „Warum ich segle“ schrieb und in denen Darwin, dreißig Jahre nach der Fahrt mit der BEAGLE, jedem Reisenden mit auf den Weg gibt:
„… gleichzeitig wird er entdecken: wie viele wahrhaft gutherzige Menschen es gibt, mit denen er nie zuvor Kontakt hatte und auch nie mehr wieder haben wird, und die dennoch bereit sind, ihm die uneigennützigste Hilfe zu gewähren.“
Hardfacts:
Werkstatt von Andelko Duzevic:
Tel. +385 (0)20 715 755
Mobile +385 (0)91 507 46 35
[email protected]
Marina Duzevic (Laden):
Tel. +385 (0)20 295 744
Mobile +385 (0)91 526 41 62
ACI Marina Korcula:
159 Landliegeplätze. 16 Dry Berths (laut offizielle Angaben auf der ACI-Korcula-Seite)
Preis für 37 Fuß: ca. 85€/Nacht
Für Transitgäste ca. 60-70 Liegeplätze, die regelmäßig Dienstag und Mittwoch
durch Flottilen und Chartersegler voll belegt sind (Stand 7/2017).
An den übrigen Tagen Reservierung ohne Probleme möglich.
Allerdings wird Buchung über das ACI-Buchungssystem (gegen Aufpreis/nicht unerhebliche Stornogebühr) gegenüber telefonischer Anmeldung bevorzugt.
Tel. 385 (0)20 711 661
Mobile +385 (0)98 398 854
[email protected]