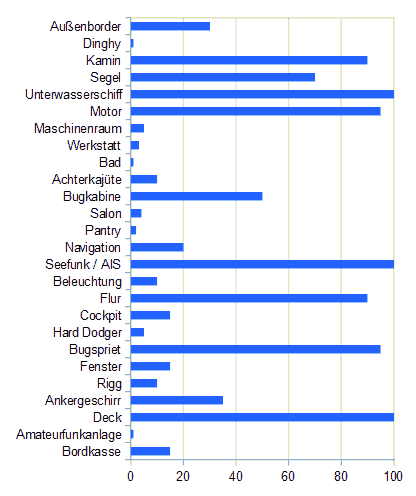„Und wenn Ihr mit Eurem Schiff irgendwo aufsetzt: Kein Problem. Einfach anrufen!“, sagt die Schleusenwärterin an der Einfahrt in den Kanal. „Wir können jeden Abschnitt bei Bedarf fluten. Dann seid Ihr gleich wieder flott!“
Sie meint es gut mit mir. Dabei hatte ich sie bloß arglos gefragt, ob Levjes 2-Meter-Tiefgang ein Problem wären im Kanal. „Eigentlich nicht“, meinte sie, „bis 2,30 Meter geht immer. Mehr Tiefgang nur nach Anmeldung.“ Tröstlich zu wissen, dass ich die nächsten Stunden immer 30 Zentimeter unterm Kiel haben werde auf der etwa 8 Stunden langen Fahrt, die die 50 Kilometer lange Halbinsel Kintyre einmal quer durchschneidet.
Wie sich das anfühlt? Auf den ersten Metern so, als würde ich über rohe Eier laufen, die jeden Moment unter den Füssen zerbrechen können. Aber kaum liegen die ersten beiden Schleusen hinter mir, bin ich wieder da, wo ich vor drei Jahrzehnten war: Beim Gefühl, hier auf einem Paddelboot entlangzufahren. Ein langsames Gleiten durch eine unbewegte Flusslandschaft. Mit jedem einzelnen Paddelschlag das Gefühl, ein störender Eindringling zu sein in dem tiefen Frieden, der über dem Fluss liegt. Auf seinen ersten Metern hinter den Schleusen von Crinan ist der Kanal nichts anderes als das, was ich einst auf der auf der Themse kurz vor Oxford oder auf der Loire fand: Ein friedliches Flüsschen, das sachte durch Hecken und Gesträuch kriecht – als gäbe es 50 Meter weiter entfernt kein wildes Meer, keine Strömungen, keinen Strom vor Corryvreckan.
Der Crinan-Kanal ist ein Veteran unter den Kanälen. Erdacht und ergraben, als britische Schiffe auf See gegen Napoleons Seeblockade kämpften, vor mehr als 200 Jahren. Und deshalb in weiten Teilen auch so geblieben, wie er um 1794 begonnen worden war. Mehr ein wasserspeisender schmaler und nicht tiefer Kanal durch einen königlichen Schlosspark. Etwas flau ist mir schon in der 2,50 Meter tiefen Badewanne, auf den ersten Metern ist sie eng zwischen den Sträuchern. Levje kommt mir vor wie ein Supertanker. Fragen kratzen allerdings an meiner Beschaulichkeit hinter dem Steuerrad. „Was mach ich, wenn ich Levjes 11,30 Meter zwischen den Hecken drehen muss?“
Oder: „Was tu ich, wenn mir in der Enge um die Ecke ein Motorboot mit Karracho entgegenrauscht?“

Schnell husche ich nach unten. Da wo Leckstopfen und Signalraketen lagern, liegt auch Trump. Trump fährt seit Jahrzehnten mit. Trump war immer schon da. Trump kann verdammt laut, lauter als alle, die ich kenne.


Und wenn Trump sich einmal bemerkbar macht, kann das keiner überhören. Trump ist unignorierbar, Trump ist ein Genie darin, unüberhörbar zu sein, solange, bis Gehör und Gehirn sich wund anfühlen. Das Beste: Trump „nutzt sich nicht ab“, „ist schwimmfähig“ und „rostet nicht“. Nur dass Trump umweltfreundlich ist, wie auf der Verpackungsröhre steht, glaub ich noch nicht ganz.

Aber hier im praktischen Leben des Crinan-Kanals ist Trump nur bedingt eine Hilfe. Das merke ich gleich an der ersten Brücke. Sie ist zu. Und sie bleibt zu. Wir eiern im engen Kanal herum, selbst nachdem ich dreimal kräftig in Trump gepustet habe, passiert eine Viertelstunde lang nichts. In Schottland verhallt Trump ungehört. Nur der schlappohrige Köter im Cottage am Ufer beginnt zu jaulen. Erst der Griff zum Smartphone bringt Bewegung in die Brücke vor uns. Ein Schleusenwärter kommt angefahren, packt seine wuchtige Kurbel aus und winscht die Brücke einfach auf zur Seite. Luxuriös, wenn das von hier ab so weitergeht auf dem 6 Seemeilen langen Kanal zwischen den Schleusen von Crinan und dem kleinen Städtchen Lochgilphead im Osten.

Sie ist mal beschaulich, die Fahrt durchs Schilf. Mal beschert sie erhabene Weitblicke, wenn sich zur Linken unter uns das Meer auftut, über das wir eben noch fuhren. Es liegt jetzt 20 Höhenmeter unter uns. Und die im Mittelmeer so beliebten PS-starken Schlauchboot-Monster? Sie fehlen nicht nur auf dem Crinan-Kanal. Sie fehlen auch auf den südenglischen oder irischen Flüssen wie River Dart oder River Barrow, auf denen ich fuhr – es gibt sie hier einfach noch nicht. Ist es fehlendes Kleingeld? Oder tatsächlich die Lust an der Beschaulichkeit?

Wie die Bergwanderer werden wir belohnt mit Stille. Und mit: Fernsicht. Und Weitblick.
Als knackig erweisen sich aber die 16 Schleusen, die man auf dem langen Weg erst rauf über die Anhöhen der Halbinsel Kintyre, dann wieder runter zu bewältigen hat. Denn sooooo luxuriös, wie wir noch an der Drehbrücke dachten, ist das alles nicht, denn ab dort sind wir auf uns allein gestellt.

Drei Paar erfahrene Hände auf einem Boot sind gerade richtig, um in der Schleuse zurechtzukommen. Zwei Kräfte an Deck, um an Bug und Heck die Leinen des Bootes in der Schleuse zu bedienen und dafür zu sorgen, dass das Boot im Gesprudel des torbraunen Wassers in der Schleuse nicht hilflos vertreibt. Und ein Mann, der am Schleusentor fürs Leeren und Füllen der Schleusenkammern per Kurbel zuständig ist.
Sven übernimmt das für uns, während Ida und ich an Deck die Leinen fieren. Irgendwann sind wir so eingespielt, dass Sven gar nicht mehr an Bord kommt, sondern an Land den Stress mit den Schleusentore übernimmt. Bis zur Erschöpfung schwingt er im blauen Shirt die Kurbel oder wuchtet zwei Paar Schleusentore auf- und zu.

Denn neben dem Bedienen der großen Kurbel fürs Leeren und Füllen ist vor allem das Öffnen und Schließen der wuchtigen Schleusentore an den langen Balkenauslegern Sklavenarbeit. Das kostet mächtig Kraft, die langen Hebelarme im Viertelkreis zu bewegen. Schon bald bleibt Sven nur noch an Land, rennt nach hinten, um die Tore wieder zu schließen, sobald wir draußen sind. Und spurtet dann voraus zur nächsten Kammer, um mit einem von der Straße weg requirierten Fahrradfahrer die Schleusentore aufzustemmen. Die langen schwarzen Hebeldinger habens in sich und sorgen dafür, dass der trainierte Bergfex Sven am Abend müde auf die Koje sinken wird..

Nein. Allein mit den langen Hebeln wäre der Einhandsegler hoffnungslos überfordert. Spätestens an einer der Schleusen im hinteren Drittel denke ich an Susanne Radlach, die Einhandseglerin, die sich ihre Segelyacht MISTRAL über 300 solcher Schleusen (in Worten: Dreihundert!!!) allein einen halben Sommer vom Rhein bis zur Rhone ins Mittelmeer geschleust hatte. „Nein“, hatte Susanne Radlach unschuldig erzählt, als wir uns in einer Bucht auf Menorca letztes Jahr begegneten, „ich hab die Fahrt über die Schleusen genossen“. Dabei sah ich in Port du Rhone schon Skipper weinen, die nach 300 Schleusen so erledigt waren, dass sie den Traum von der großen Segelreise einfach in den Wind schlugen und entnervt nach Hause reisten.
Oder Klaus Aktoprak, der in seinem Buch Schärensegeln seine Fahrt auf dem Götakanal quer durch Südschweden beschreibt. Satte 58 Schleusen musste er einhand bewältigen und wusste hinterher, warum man den Götakanal auch „divorce ditch“ nennt, den „Scheidungsgraben“, in dem sich Mann und Frau auf einem Boot heillos über der Bedienung der Schleusen in die Haare geraten.

Anstrengend ist das mit den Schleusen allemal. Als wir am Spätnachmittag aus der letzten Schleuse in Lochguilphead von der Höhe ein letztes Mal hinunterschauen aufs offene Meer, spüre auch ich die Anstrengung des Tages.
Am Ende meines Tages durch den Crinan-Kanal – und es gibt vier solcher für Segelyachten schiffbarer Kanäle durch Schottland – ziehe ich mein Fazit:
Es ist tatsächlich eine enorme Zeitersparnis, diese Abkürzung „über Land“ zu nehmen. Mit diesen 6 Seemeilen erspart man sich 100 Seemeilen um die Halbinsel Kintyre und dessen Südende Mull of Kintyre, über dessen Strudel und Wildheit ich schrieb.
Ich war froh um Sven und Ida. Einhand wäre das gleichzeitige Schleusenbedienen, Leinenarbeit und Boot bewegen nur umständlich und zeitraubend machbar gewesen. Ich wäre in der Schleuse zum zeitraubenden Verkehrshindernis für andere geworden.
Die Warterei hat auch ihr Gutes: In der Enge der Schleusenkammer kommt man sich näher. Ein Plausch mit der rothaarigen Schleusenwärterin über ihr Leben als Mutter und Schleusenwärterin. Ein „Woher? Wohin?“mit dem Nachbarskipper aus Glasgow – wie immer im Leben schafft Mühsal Gemeinsamkeit und Vertrautheit, die man so selbst im Hafen selten findet.
Manche der Schleusentore sind technisch in schlechtem Zustand – und nicht nur die, die die Jahreszahl 18-Hundertirgendwas tragen. Sie allein zu bewegen, ist gelegentlich unmöglich. Allerdings bieten jüngere „Pilots“ an Schleusen ihre Dienste an. Zum ohnehin nicht günstigen Preis von 160 Pfund für die einfache (!) Fahrt, für die wir 8 Stunden brauchten, kommen dann noch Entlohnung für die Pilots dazu.
Fazit: Wie schon der Kanal von Korinth ist auch der Crinan Kanal ein Vergnügen – wenngleich es schon Anstrengung kostet und seinen Preis hat.
Doch ich habe den Tag binnen sehr genossen. Nicht zuletzt wegen der Fernsicht. Und des Paddelboot-Feelings.