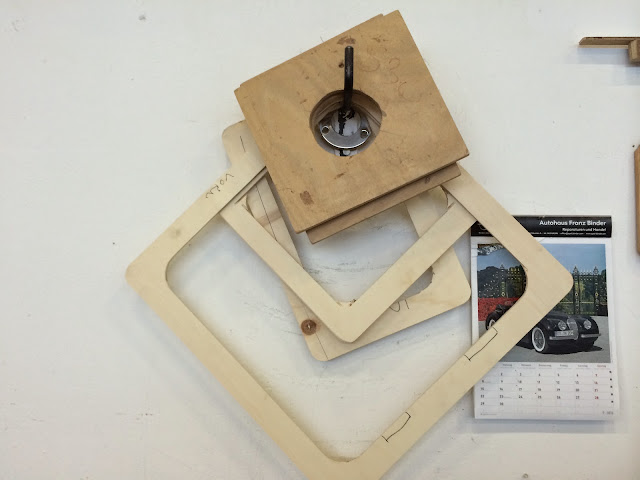Was ist eigentlich Segeln?
Für die einen ist es das Nonplusultra. Das, wofür sie leben, auch wenn sie im täglichen Leben etwas ganz anderes machen. Und fest im Leben stehen. Vor vielen Jahren las ich die Geschichte eines Chirurgen, dessen Tochter sagte: „Eigentlich hat mein Vater nur fürs Segeln gelebt. Für die Stunden auf dem Wasser. Er hat seinen Beruf geliebt. Und seine Familie. Aber gelebt hat er nur für die Stunden auf dem Wasser.“
Wie leicht kann jeder die Bilder dieses Sommers in sich wachrufen, jetzt, wo die Dunkelheit der Nacht am längsten und der Tag nicht über ein kurzes Grau hinauskommt. Damit ich nicht vergesse. Die Bilder, die ich oft in quälend langen Meetings wachrief: Das Türkis des Meeres im Juli, das oft in ein Grün übergeht, bevor der Regen einsetzt.
Damit ich nicht vergesse.
Segeln ist: Im Niedergang sitzen und dem Regen zuschauen.
Segeln ist: Auf dem Vordeck in der Sonne liegen, Musik hören, während LEVJE im Wind schwoit. Segeln ist: das Sieben-Uhr-Abendläuten an einem Sommerabend ankernd in der Bucht von Cres. Der Frieden im Hafen von Antalya, ein Glas kalten Weiswein in der Hand, nach einem langen Segeltag.
Segeln ist: Nachts in LEVJE’s Koje leicht in den Schlaf gewiegt werden. Ein schwereloses Schaukeln. Und Einschlafen im leisen Geplätscher an der Bordwand.
Segeln ist: Neugierig hinter jede Huk schauen wollen, immer weiter. Fahren wollen, immer weiter. Segeln ist…
Damit ich nicht vergesse:
Segeln ist:
Herausfinden, was man wirklich braucht.
Was man nicht braucht.
Als ich die ersten 10 Wochen auf dem Meer unterwegs war, schrieb ich einen Beitrag darüber, was ich brauche. Und was ich nicht brauche. Es waren überwiegend einfache Dinge, die im Gegenzug zu vorher plötzlich Bedeutung hatten.
Meinen Hut. Als Schutz vor sengender Sonne.
Die Flasche Wasser in der Juli-Hitze.
Das Ipad, auf dem ich meine gesamte Navigation mache. Und weil es meine Verbindung zur Welt ist. Und noch einige Sachen fielen mir ein. Aber es waren alles sehr, sehr einfache Dinge.
Das Leben wird auf verblüffende Weise einfach, man braucht kein Buch mehr zu lesen mit dem Titel „Simplify your Life“. Denn das Leben wird einfach, auch in den paar Wochen, die man als „Jahresurlaub“ auf dem Meer verbringt. Es ist, als würden Leinen von uns abfallen, die uns in diesem Augenblick hierhin zerren. Und im nächsten dorthin – aber selten in die Richtung, in die WIR ursprünglich eigentlich mal wollten. Das Gezerre: es hat ein Ende. Beim Segeln.
Weiterlesen bei: Resümee nach 10 Wochen. Hier.
Weiterlesen bei: Wär ich Gott, würd ich hier
wohnen: Im Dom von Trani. Hier
Segeln ist:
Wir. Und die Elemente.
19. Dezember 2014. Ein Tag irgendwo in einem wohlhabenden Land mitten in Europa:
Es ist schwierig, die Kräfte und Mächte zu verstehen, die an diesem Tag in diesem Land auf mein Leben einwirken. Und vor allem: mein Leben sehr dominant bestimmen.
Die Elemente, die Jahrtausende unser Leben bestimmten, haben wir gezähmt. Scheinbar. Der Winter macht uns keine Angst mehr. Ein Gewitter nehmen wir in unserer zentralbeheizten, vollgedämmten Wohnung kaum noch wahr. Ein trockener Sommer, der früher Hunger verhieß, bringt uns nicht um. Was früher sichtbar Einfluß hatte auf unser Leben ist heute gebändigt. Es zeigt nur gelegentlich die Krallen: Tsunamis, Taifune, Orkankatastrophen, die kennen wir nur mehr aus dem Fernsehen. Was früher unser Leben bestimmte: es ist weg.
Aber vor allem: Es wurde ersetzt durch Kräfte und Mächte, die wir nicht mehr sinnlich erfahren. Und schlimmer noch: nicht mehr verstehen. Warum hat der Zug heute früh schon wieder eine halbe Stunde Verspätung? Und schmeißt meinen Tag um? Ein Aufsichtsrat nickt die Entscheidung seines Vorstands ab, diese oder jene neue Firma zu gründen. Oder dieses oder jenes Produkt massiv in den Markt zu drücken. Was ist das, „Aufsichtsrat“? Hat es ein Gesicht? Kann ich es beschimpfen, gar ohrfeigen, wenn ich wütend bin? Irgendeines Unternehmens Werbekampagne weckt den Wunsch in mir, dieses oder jenes sofort zu bestellen, zu kaufen, „haben“ zu wollen. Kenne ich dieses Unternehmen? Na klar, sagen wir: „ich kenne die Marke“. Aber kenne ich meine Beweggründe, warum ich dies, das, jenes jetzt haben will? Und: wenn ich anfange, in dem Brei, „Marke“ genannt, herumzukratzen, auf den Boden des Topfes schauen zu wollen: was bleibt dann? Am Boden des Topfes oft nicht mehr als die leere Begriffe. „Umsatz“, „Shareholder Value“, „Wachstum“, „Rendite“ haben kein Gesicht.
Nein, die Kräfte, die bestimmend auf unser Leben einwirken, sind nicht mehr zu verstehen. Anders als früher Gott, haben sie kein Gesicht. Sie sind zu vielfältig geworden. Es ist zu komplex geworden.
Für den, der segelnd auf dem Meer unterwegs ist, reduziert sich die Undurchschaubarkeit dessen, was unser Leben bestimmt, ganz erheblich: „Nordwest 4-5 mit Seegang 2.“ Dies ist die Kraft, die heute meinem Segeltag bestimmt. Segeln schärft den Blick, für das, was unser Leben bestimmt. Und was wirklich in diesem Leben wichtig ist.
Klar gibts auch da Unvorhergesehenes: LEVJE’s Kühlwasserpumpe, die plötzlich mitten in den Wellen den Motor warnend pfeiffen läßt, weil sie den Geist aufgibt. Der Meltemi, der halt nicht als „Nordwest 4-5“, sondern als „6-7“ daherkommt. Oder eine leichte Lebensmittelvergiftung, die mich flachlegt. Oder ein Hafenmeister, der vor LEVJE austickt.
Wir beherrschen die Kräfte, die unser Leben bestimmen, auf dem Meer ebensowenig wie die Kräfte an einem x-beliebigen Tag in dem wohlhabenden Land mitten in Europa. Der Unterschied ist: auf dem Meer verstehen wir die Kräfte, die auf unser Leben wirken. Wir sehen sie. Wir können sie sinnlich erfahren. Wir können uns auf sie einstellen. Wir verstehen sie. Fast zu 100%. Sie sind einfach.
Und vielleicht ist es das, was uns auf dem Meer sagen läßt: „Das Leben ist hier draußen so wunderbar einfach.“
Weiterlesen bei: Reden wir mal über die Angst. Hier.
Weiterlesen bei: 5 Monate Segeln – was bringt das? Hier.
Weiterlesen über den grollenden Hafenmeister von Peschici und
das liebe Geld? Hier.
Segeln ist:
„Da wird eine Taste gedrückt.
Und ein Urprogramm beginnt unweigerlich in uns abzulaufen.“
Für die manchen ist Segeln auch ein bisschen Hassliebe. Eigentlich ist für sie ihr Leben, das sie am Land leben, vollkommen in Ordnung. Es passt alles. Alles ist gut. Und im Lot.
Aber wehe, wenn sie auf dem Meer unterwegs sind: Dann ist alles anders. Der Blick in die Weite. Der leichte Wind, der besänftigend durch die Alltagsklamotten streicht. Das sanfte Wiegen auf dem Wasser. Dann wird etwas aufgerufen. Etwas wachgeküsst. Etwas, was mir Richard, ein alter Segler auf einem meiner ersten Törns mit den Worten des Ingenieurs und Erfinders, der Richard im Leben nun mal war, so erklärt hat: „Es ist, als wären wir ein Kassettenrecorder: Am Meer wird in uns eine Taste gedrückt. Und ein Lied oder ein Software-Programm, dass seit Urzeiten in uns einprogrammiert ist, beginnt zu laufen.“
Segeln ist:
„Das dümmliche Grinsen.“
Gelegentlich kommen, wie auf meiner fünfmonatigen Reise von Triest nach Antalya, auch Menschen aufs Boot und begleiten mich ein Stück. Freunde, die schon mal mitgesegelt sind. Meistens nehme ich jemanden mit, Freunde, Kollegen, weil ich denke, dass wir uns etwas zu sagen haben. Ich stelle mir vor, dass ich gerne mit Ihnen einen Abend in der Bucht verbringe: Dass wir gemeinsam abends Gedanken übers Leben lustvoll & locker drehen und wenden, so wie eine Auberginenscheibe in Mehl und Ei, bevor sie in die Pfanne kommt. Manchmal sind es Menschen, die ich gut kenne. Und die das Segeln kennen. Manchmal sind es Menschen, die ich kaum kenne. Denn am liebsten nehme ich Menschen mit, die eigentlich noch nie gesegelt sind. So wie Andreas, der mich in diesem Sommer begleitet hat vom Peloponnes bis Milos. Es hat mich immer gereizt, Menschen mitzunehmen, die noch nie gesegelt sind. Darüber, wie man vorher rausfindet, ob Segeln etwas für jemanden ist, ob er seekrank wird oder nicht, schrieb ich bereits in meinem Beitrag über das Segeln mit Nichtseglern.
Weiterlesen bei: Segeln mit Nichtseglern.
Um herauszufinden, ob sich jemand beim Segeln auf dem Boot wohlfühlt, gibt es einen einfachen Dreh: Sind die Leinen los, sind wir vom Liegeplatz weg, sind wir draußen unter Segel, dann drücke ich demjenigen einfach LEVJE’s Pinne in die Hand: „Halt mal kurz.“ Ganz absichtslos.
Für den, der noch nie gesegelt ist, ist die Pinne ein totes Stück Holz. Ein Fremdkörper. Etwas, das so verkehrt in der Hand ist wie 15 Regenwürmer. Aber oft stellt sich auf dem Gesicht desjenigen etwas ein, was ich „das dümmliche Grinsen“ nenne. Konzentration. Entspannung. Freude. Darüber, wie sich das Schiff, LEVJE, anfühlt, wenn man sie durch die Wellen steuert. Wie sich LEVJE leicht auf die Seite neigt und beginnt, mit leicht wiegenden Bewegungen durch die Wellen zu gleiten, zu schnüren wie ein Fuchs, der im Schnee konzentriert einer Fährte folgt. Dreieinhalb Tonnen, die sich, schwer wie ein 31-Fuß-Stahlcontainer, doch leicht wie eine reinweiße Feder vom Wind fortwehen lassen. Ein leichtes Grinsen im Gesicht. Ein Konzentriertsein auf das Schiff, auf LEVJE, und wie sie auf leichte Bewegung der Pinne reagiert. Es ist viel, was sich in so einem Moment auf dem Gesicht desjenigen abspielt. Aber das „dümmliche Grinsen“: es ist unübersehbar. Es kündet von Glück. Und davon, dass hier eine(r) angekommen und am richtigen Platz ist.
Segeln ist:
„Meinen Ort finden.“
Sulu Adasi, die Insel Sulu: eine Tagesreise südsüdwestlich von Antalya gelegen.
Segeln: das ist für mich meinen Ort finden. Nein, keinen bestimmten geografischen Ort auf der Landkarte, den man einfach nur finden müßte, weil man dann dort, ja nur dort: glücklich sein, sein Glück finden könnte. Nein, darum geht es nicht.
Der Ort, um den es geht, ist ein anderer: Der Ort ist: „Wer bin ich in der Welt?“ Denn so merkwürdig es ist: auf dem Meer weiß ich das. Denn die Wellen und vor allem eine vergessene Insel wie Sulu, sie liegt eine halbe Tagesreise südlich Antalya, die ordnen mich ein in die Welt. Sie betten mich ein in den Kosmos. Und ich verstehe plötzlich, wenn der Anblick von Sulu mir sagt: Du bist zwar ein unendlich kleines Teil im Getriebe der Welt. Unendlich mikroskopisch klein in den Jahrmillionen, die es brauchte, um dieses Inselchen so zu schaffen, wie es heute unbewohnt, vergessen, gleichgültig im Meer liegt. Und doch: Du bist. Ein Teil des Ganzen.
Um dies zu verstehen, ist es notwendig, kurz in den westlichen Teil des Mittelmeeres zurückzukehren, nach Capraia nördlich von Elba. Es war in der Bar Massimo auf Capraia, wo ich vom Tod meiner Großmutter erfahren hatte. Sie war gestorben in ihrem 97. Jahr, genau einen Tag nach ihrem Geburtstag und wenige Tage, nachdem ich sie ein letztes Mal besucht hatte. Ein paar Monate, nachdem sie, wie mancher alte Mensch es tut, einfach beschlossen hatte, nichts mehr zu sich zu nehmen. Und wie ein alter Elefant ins Dickicht zu gehen, allein, um sich zum Sterben niederzulegen, irgendwo. Sie hatte mehrere Wochen nichts mehr zu sich genommen, war in ein Dämmer hinübergeglitten, irgendetwas zwischen Schlaf und Ohnmacht, aß nicht mehr, trank nicht mehr, sprach nicht mehr, reagierte nicht mehr. Nur noch ihre geliebte Tasse Bier, die ließ sie sich von mir ein paar Tage vorher zum Mund führen.
Als ich von ihrem Tod erfuhr, war ich traurig. Traurig, weil sie nicht mehr da war, traurig, weil wir das, was wir gemeinsam hatten, unsere Begegnungen nun wirklich und endgültig Vergangenheit und vorbei waren. In dieser Stimmung waren wir um Korsika herum unterwegs. Ich hörte abends im engen Hafen von Bastia den überwältigenden Klang der Kirchenglocken. Und dachte an meine Großmutter. Wir umsegelten die Südspitze von Capraia, da wo lange Steinreihen aus wer weiß welchem urgeschichtlichen Erdzeitalter sich die kargen Hänge hinaufziehen, eine Steinreihe neben der anderen, ein Stein nach dem anderen: als hätte hier ein uraltes Volk einen Kultort hinterlassen. Ein Denkmal, bei dem alle unsere Vorfahren, unsere Ahnen, zu Stein geworden, aufgereiht stehen. Einer nach dem Anderen. Vom ersten Bakterium, mit dem alles begann, über jeden, jeden einzelnen, der daraus entsprang und danach kam, bis hin zu mir. Eine lange, lange Reihe. Vor mir. Keiner auch nur denkbar ohne den davor. Ohne all jene davor, die notwendig waren, um diesen einen hervorzubringen. Und das Leben weiterzugeben.
In diesem Augenblick auf Capraia fühlte ich, wie stark diese Verbindung ist, ich stellte mir die Gesichter all derer vor, die meine Vorfahren waren: Sammler, Jäger, Bauern die meisten. Männer und Frauen. Bettler, Königinnen, Heilige, Mörder waren sicher darunter. Priester und Pestkranke. Mönche und Magnaten. Bauern und Betschwestern. Und Sänger und Säufer. Bei mir, bei jedem von uns. Wir sind die Summe, das Endergebnis einer unendlich langen Reihe von Lebewesen, von Menschen. Manchmal, wenn ich in dem wohlhabenden Land mitten in Europa gerade nicht weiß, wer ich bin: dann stelle ich sie mir vor: die lange Reihe der Lebewesen, die nötig waren, um mir das Leben zu geben. Mir die Fackel in die Hand zu drücken. Und jetzt bin ich der, der gerade die Fackel trägt. Und sie weitergeben wird.
Und dies ist, was mir oft das Reisen auf dem Meer vermittelt: Meinen Ort in der Welt. Winzig, winzig klein, und unbedeutend wie die karge unbewohnte, die vergessene Insel Sulu. Und doch ein Teil des großen Ganzen. Verbunden mit allem. Im weiten Meer.
Weiterlesen bei: Die rätselhaften Vogelmenschen der Daunier. Hier.
Sie möchten jeden neuen Artikel von Mare Più gleich bei Erscheinen erhalten?
So geht’s :
1. Einfach E-Mail-Adresse oben rechts bei „News & neue Artikel… eintragen“.
2. Bestätigungsmail von FEEDBURNER abwarten.
3. Den Link im FEEDBURNER-Mail einfach anklicken. Fertig.