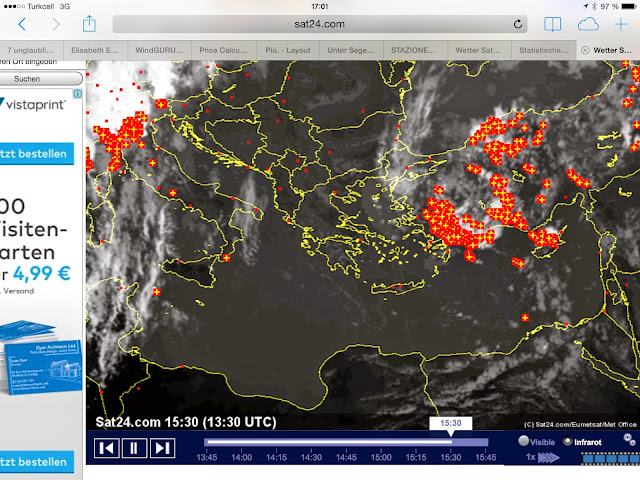Einfach mal ein halbes Jahr mit dem Boot verschwinden. Segeln, so lange Lust und Wetter mitmachen. Um jede Huk herumkucken, um die man immer mal herumkucken wollte: Das war mein Traum über 16 Jahre. Aber wie es so geht: es passt halt gerade nicht. Familie. Kinder. Ein spannender Job. Oder aber: Keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll?
Fangen wir mal an mit: Geld. Segeln, heißt es, muss nicht teuer sein. Ein Freund, Software-Programmierer, ist mit Frau und zwei Kindern vor einigen Jahren auf einer 37er von Slowenien aus Richtung Australien aufgebrochen. Von dort aus macht er auch seine Software-Hotline. Was keiner seiner Kunden weiß. „It’s perfect life!“ mailt er einmal monatlich. Mit 25.000 Dollar für eine vierköpfige Familie im Jahr kommt er aus.
Aber wie sieht die Wirklichkeit in unseren Revieren aus? Was kostet ein Mittelmeer-Törn, 5 Monate von Slowenien über Italien, Griechenland bis weit in die Türkei wirklich?
Die beiden wichtigsten Faktoren, wie teuer eine Segelreise wird, hat man selbst in der Hand.
Entscheidend sind:
1. Die Schiffsgröße

Eine Lösung? Ein Trimaran, den man bei Bedarf im Hafen in Länge und Breite auf die Hälfte „schrumpfen“ kann:
Deutlich sieht man über dem Außenborder eine der Stahlschienen, mit deren Hilfe die Achterkoje einfach um etwa 1,50
herangeholt wird, ebenso wie die Bugkoje und die beiden Schwimmer. Selbst der Mast ist via Mechanik kürzbar. Ob sich
dieses Konzept durchsetzen wird: ich bin skeptisch.
„Draußen auf See: so groß wie möglich.
Drinnen im Hafen: so klein wie möglich.“
Das ist mein Resümee nach vielen Jahren Segeln im Mittelmeer. Ein großes Schiff – und darunter verstehe ich alles über deutlich 10 Meter Bootslänge – ist komfortabler. Vermittelt mehr Sicherheit. Liegt ruhiger in der Mittelmeer-Hacksee. Man segelt einfach entspannter. Die Bootsbewegungen sind viel ruhiger.
Aber: was draußen auf dem Meer Sicherheit & Komfort bedeutet: kommt im Hafen beinhart auf die Rechnung: Liegeplätze berechnen sich nach Schiffslänge. Oder wie in der Türkei nach Quadratmetern. Ebenso wie Kosten für Permits und Transitlogs.
Und genauso steigen die Kosten für Unterhalt – vom Kranen angefangen bis zum „Hardstand“, dem Landliegeplatz.
Und wer an seinem Boot einmal jährlich das Antifouling selbst aufbringt: Mit dem Pinsel in der Hand wird eine größere Yacht an der breitesten Stelle beim Streichen plötzlich „verdammt lang“.
2. Die Wahl des Segelreviers
„Es gibt Reviere, da geht man jeden Abend in den Hafen.
Und solche, da geht man zwei mal im Monat in den Hafen.“
Unterstellen wir einfach, Sie haben sich – ob gekauft oder gechartert – nach langen, langen, langen Erwägungen aus diesen oder jenen Gründen für eine bestimmte Schiffslänge entschieden. Sie haben ein Schiff. Und leben damit. Und haben sich an die Kosten gewöhnt. Dann bleibt als wesentlicher Kostenfaktor die Wahl des Reviers. Und ihre Route.
2.1 Italien ist wunderschön.

Von Venedig aus fuhr ich mit LEVJE nicht übers offene Meer, sondern über die „Canali“ nach Chioggia: Italien lockt mit
Ungewöhnlichem. Über diese Reise berichtete ich ganz am Anfang.
Italien hat aber mit ungefähr 200 Inseln vergleichsweise wenig Inseln. Und noch weniger Buchten. Also muss man fast jeden Abend in den Hafen. Das kostet Liegegebühren. Und schon die alten Fahrensleute wußten: „Hafen meiden! Die Kohle ist weg!“.
Denn erstens spürt man die Liegegebühren – sie liegen je nach Hafen im CIRCOLO NAUTICO oder bei der LEGA NAVALE für ein 31-Fuß-Schiff zwischen 20 und 50 €. Auf der wunderschönen Insel Ponza kann das auch mal 100 € betragen. Und im schönen Porto Rotondo an der Costa Smeralda stehen im schönen August schon mal 133,76€ pro Nacht für LEVJE’s 31 Fuß auf dem Zettel.
Ein weiteres kommt hinzu: Als Freund guten Essens und guter Weine bin ich Italiens Küche ausgeliefert. Wehrlos. Hilflos. In Italien hält es mich abends nur selten auf LEVJE. Die Stadt ruft: Mit hervorragenden Fisch-Antipasti. Pasta in 1001 verführerischen Variationen. Wein zum „Sich-vergessen“. Da kostet ein vierwöchiger Italientörn mit einem 31 Fuß Boot für eine Person schnell mal 2.500 Euro aufwärts, Treibstoff und Liegegebühren eingerechnet. Dafür aber lebt man ein herrliches Leben. „Si mangia a Dio“, man isst wie bei Gott, sagte mir der Marinaio in Ancona über das Restaurant genau vor Levje’s Bug. Womit er wahrhaftig nicht log.

Was Sie sonst noch für einen längeren Törn an Italien’s Küsten über Gebühren, Vorschriften, Wetterdienste, Internet wissen müssen: Hier weiterlesen.
Wie man über die Kanäle von Venedig nach Chioggia kommt: Hier weiterlesen.
2.2 Griechenland ist wunderschön.

Keine nennenswerten Permit-Gebühren, außer für das DECPA. Und für die Einreise pro Person.
Viele, viele wunderschöne Buchten locken von Othonoi im äußersten Nordwesten bis nach Kastellhorizon, der letzten griechischen Insel einen Kilometer vor dem südtürkischen Kas im äußersten Südosten. Man kommt also auch bei schlechtem Wetter hervorragend ohne Marinas aus.
Von Juni bis September wehen für die Route von Nordwest nach Südost günstigste Winde. Der Meltemi bläst kräftig mal mehr von Nord, mal mehr von Nordwest. Es ist eine Freude, noch vor dem Anker-auf Morgens die Segel zu setzen. Und Abends, nachdem der Anker gefallen ist, die Segel zu bergen. Und 200 Meilen unter Segel mit Treibstoffkosten für insgesamt 7 Liter Diesel sind bemerkenswert erfreulich.
Hinzu kommt: Es gibt wenig gut ausgebaute Marinas. Aber überall Häfen. Und in denen kostet das Anlegen meist wenig. Das merkt man schnell: Bereits für 800 Euro aufwärts im Monat lebt es sich in der Ägäis ganz wunderbar. Aber nicht täuschen lassen: Auch wenn Lebensmittel und das hervorragende Obst und Gemüse in Griechenland günstig ist: Ausgerechnet hier sind landestypische Produkte wie mein geliebter PHAGE-Joghurt, Oliven, Schafskäse vergleichsweise teuer. Dies Rätsel zu lösen bleibt einem weiteren Artikel vorbehalten.

Restaurantbesuche – wie hier auf der zauberhaften Hafenmole von Monemvasia – spielen kostenmäßig in
Griechenland eindeutig auf niedrigerem Niveau als in Italien und dem in dieser Hinsicht kein Pardon kennenden
Süd-Frankreich.
Was Sie sonst noch für einen längeren Törn an Griechenland’s Küsten über Gebühren, Vorschriften, Wetterdienste, Internet wissen müssen: Hier weiterlesen.
2.3 Kroatien ist wunderschön.

Hier wird es – ebenso wie in der Türkei – aufgrund gehobener Liegegebühren in den Häfen etwas teurer. Für ein 31-Fuß-Schiff ist mit 35-60€ pro Nacht zu rechnen. Aber man hat es als Segler ja selber in der Hand, ob man ankert oder jede Nacht im Hafen verbringt. Und das stellen die kroatischen Marinabetreiber zu ihrem Leidwesen auch gerade fest: Die Zahl der Bootsbesitzer, die im Urlaub jeden Tag die Marina aufsuchen, nimmt aufgrund stark angestiegener Mooring-Gebühren ab. Ausnahme: Schlechtwetter-Tage.

In Kroatien kommt noch das relativ teuere Jahrespermit hinzu, es kostet für LEVJE’s 31 Fuß an die 200€.
Etwas ungünstig sind auch die Windverhältnisse in der Adria: immer noch gilt gerade für die obere Adria der gute alte Spruch „entweder zuviel Wind oder zuwenig.“ Gerade in den Sommermonaten ist viel Motoren angesagt bei schwachen Winden: Das erhöht die Kosten spürbar.
Preise für Restaurants und Konoben, die sich gerade in unmittelbarer Hafennähe befinden, haben in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich zugelegt.
2.4 Slowenien. Ein begeisterndes kleines Ländchen.

Der Hafen von Izola. Die Ausfahrt aus dem Hafen von Izola und den Start meines fünfmonatigen
Törns stelle ich auf einem Video in einem meiner ersten Posts vor.
Der Vollständigkeit halber sei auch Slowenien erwähnt, das zwar nur über 25 km eigene Seeküste verfügt, aber neben Koper und Portoroz vor allem mit Izola einen hervorragenden Yachthafen mit kürzesten Wegstrecken sowohl am Land als auch zu Wasser nach Norditalien und Venedig besitzt. Hier ist das Preisniveau in den drei Marinas dem in Kroatien vergleichbar. Allerdings werden hier keine Gebühren für Permit verlangt.

Segeln an Weihnachten: LEVJE im Hafen von Piran, Slowenien am 2. Weihnachtsfeiertag 2013.
Da die vier slowenischen Küstenstädte Koper, Izola, Piran und Portoroz noch immer zu einem Gutteil von slowenischem Inlands-Tourismus leben, ist das Preisniveau vor allem in den Restaurants von Koper und Izola erfreulich niedrig. Piran ist mit seinem hübschen venezianischen Hafen natürlich ein Touristenmagnet, während Portoroz seit seiner Gründung als k. und k. Seebad seinen „Hang zu Höherem“ in unnötig hohen Marina- und Restaurantpreisen fortsetzt.
Was Sie über Slowenien wissen sollten: Hier weiterlesen.
Das Video zur Ausfahrt aus der Marina von Izola: Hier.
2.5 Türkei. „Hello, my Friend.“

Ein phantastischer Ort selbst im späten Oktober: Das antike Phaselis, zwischen Finike und Kemer auf einer Halbinsel
gelegen. Hier – zu Füßen des über 2.300 Meter hohen Tahtali Dag, über den ich vergangene Woche berichtete –
überwinterte schon Alexander der Große.
Für die Türkei gilt Ähnliches wie für Kroatien. In den zurückliegenden Boomjahren ist Segeln – vor allem bei gut verdienenden Türken in den Großstadt-Zentren Istanbul, Izmir, Bodrum, Antalya – sehr in Mode gekommen. Vor allem „Großstadt-nahe“ Häfen (Turgutreis, Bodrum selbst, Marmaris und erstaunlicherweise Antalya) sind teuer, weil überwiegend von bootsbegeisterten einheimischen Stadtbewohnern belegt. Für LEVJE’s 9,40m Länge waren pro Nacht in den genannten Häfen zwischen 37€ und 45€ zu berappen. Strom, Wasser (5€ pauschal) sowie WIFI kommen gegebenenfalls noch dazu. Vier Nächte – kein Spaß. Zumal die Marinas von Bodrum und Marmaris von ihrem täglichen und vor allem: nächtlichen Lärmpegel unerträglich sind. Und die Marina Antalya eine halbe Busstunde außerhalb des Zentrums liegt im Industriehafen liegt – weitab von Restaurants und vernünftigen Einkaufsmöglichkeiten und dem: was der Seemann nach paar Tagen auf See gerne hätte.
Auf dem abgelegenen Land sieht es anders aus: In Kas oder Finike, aber auch in Alanya sind die Häfen günstiger. Und gemütlicher. Und vor allen Dingen: LEISER! Hier ist man mit um die 25€ dabei. Strom, Wasser, WIFI sind – meist – inklusive.
Hinzuzurechnen sind in der Türkei noch die Kosten für das Transitlog (52€) sowie den hierfür erforderlichen Agenten (Von 0€ bis 80€ ist alles drin: das hängt von Ihrem glücklichen Händchen ab) sowie die unabdingbare BlueCard (25€). Es summiert sich also auch auf ein dem kroatischen Permit vergleichbares Preislevel.

Der Restaurant-Steg des Restaurants RAFET BABA in der Bucht von Ciftlik, ein paar Meilen vor Marmaris. Wer hier
liegt, liegt kostenlos. Erwartet wird aber, dass im zugehörigen Restaurant gegessen wird.
Essen gehen: Hier gibts einen einfachen Indikator: In Gegenden, in denen man Sie mit den Worten „Hello, my friend“ begrüßt, können Sie pro Person von 25€-35€ ausgehen. Dies gilt für die landschaftlich sehr reizvolle Buchtenecke mit den netten Stegrestaurants zwischen Bodrum und bis östlich Marmaris, etwa bis Gemiler-Reede.
Danach kommt die Ecke ohne „Hello, my friend“. In den liebenswerten Orten Kas und Finike, die vom Tourismus wirklich verschont sind, zahlt man um die 10€ – 15€ für zwei, drei Gänge. Übrigens erzählte mir Eda, dass auch Sie als Türkin vor der Begrüßung „Hello, my friend“ nicht verschont bliebe. Ob Türke oder Deutscher: man ist Tourist. DAS bestimmt das Preisniveau in der Türkei.
Lebensmittel in der Türkei: Vor allem Alkoholica, Bier und Wein, sind vergleichsweise teuer, da dem rechtgläubigen Muslim nicht gestattet. Und deshalb mit Steuern belegt. Und auch nicht überall erhältlich.
Insgesamt kommt man für vier Wochen Türkei also auf etwa 1.500€.
Was Sie sonst noch für einen längeren Törn an den Küsten der Türkei über Gebühren, Vorschriften, Wetterdienste, Internet wissen müssen: Hier weiterlesen.
Und falls Sie der am Meer gelegene, über 2.300 Meter hohe Tahtali Dag interessiert: Hier lesen.
Und wie sieht das für andere Länder aus?
Frankreichs Mittelmeer-Küste sicherlich teurer, Spanien ebenfalls.
Nord- und Ostsee: je nachdem. Liegegebühren meist unter den fürs Mittelmeer genannten Preisen.
Karibik: Kann man so oder so machen: Anreise teuer. Kann aber gut überall ankern und buchteln. Essen gehen? Bleibt in den meisten Teilen der englischsprachigen Karibik verzichtbar, da die „amerikanische Küche“ in ihrer „fast form: paniert, frittiert“ dominiert.

Phaselis, Ende Oktober: einer der drei Häfen der untergegangenen Stadt.
Mein Fazit:
Ist Segeln also teuer? Das kommt darauf an. Auf einem fünf-Monatstörn durch die genannten vier Mittelmeer-Länder muss man – bei meinen genannten drei Vorlieben viel Ankern, gut Essen, guter Wein – mit monatlichen Ausgaben um die 1.600€ rechnen. Fünf Monate machen also 8.000€, und wer ganzjährig auf dem Boot lebt, wird also um die 20.000€ für ein Jahr an den Küsten des nördlichen Mittelmeeres in der Reisekasse haben müssen.
Nicht teuer ist Segeln, betrachtet man es unter dem Gesichtspunkt: „Wieviel Urlaub krieg ich für 1.600€?“ Denn für diesen Betrag bekommen Sie im nächsten Sommer – und der kommt bestimmt – wahlweise:
2-3 Wochen Alanya All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel
7 Tage „Malle“, nettes Hotel, aber nur Übernachtung mit Frühstück
5 Tage New York, nur Übernachtung, 7th Avenue nahe Penn Station
15 Tage Kreuzfahrt Venedig, Kusadasi, Santorini, Valetta, Venedig auf der Norwegian Jade.
Ich glaub‘: Ich verbringe auch den nächsten Sommer auf LEVJE.